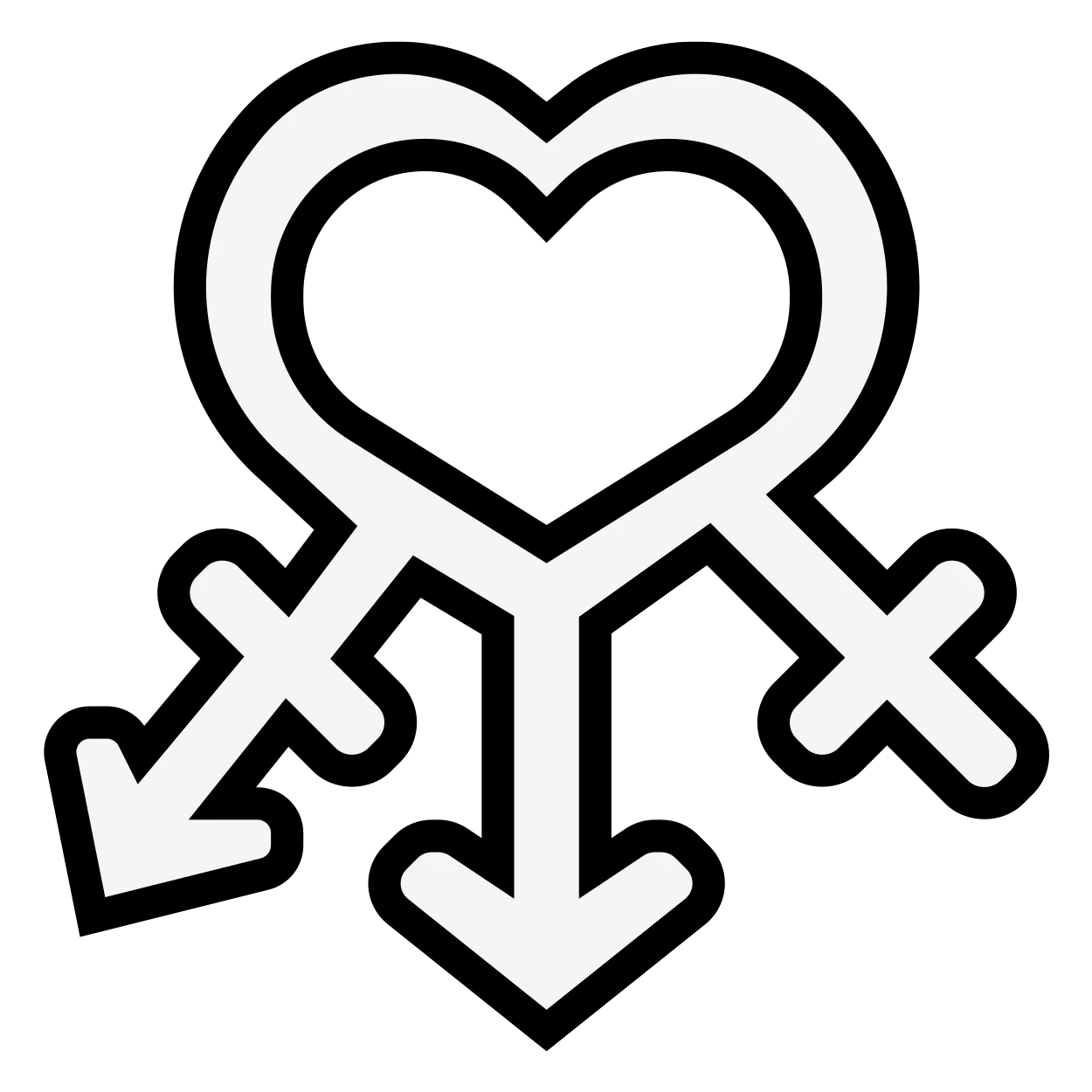Vater und Sohn haben einen Autounfall. Der Vater stirbt, der Bub wird in die Notaufnahme gebracht, wo ein Arzt gesucht wird. Doch als die OP starten soll, gibt es ein Problem: "Ich kann ihn nicht operieren – er ist mein Sohn." Wer ist die herbeigeholte Person? Hast Du für einen winzigen Augenblick gezögert? Die Antwort ist natürlich: die Mutter des Jungen. Dieses bekannte Rätsel zeigt, wie tief verankert unsere Sprachbilder sind. Wenn wir "Arzt" hören, denken die meisten von uns zuerst automatisch an einen Mann.
Ein persönliches Geständnis
Ehrlich gesagt: Ich habe lange nicht viel über geschlechtergerechte Sprache nachgedacht. Als Frau hatte ich nie das Gefühl, bei männlichen Anreden nicht „mitgemeint“ zu sein. Gut möglich, dass das viel damit zu tun hat, dass ich mit zwei Schwestern aufgewachsen bin. Unsere Eltern haben uns nicht stereotypisch „weiblich“ erzogen – wir sind auf Bäume geklettert, haben mit Puppen und im Gatsch gespielt. Dass ich mich in Bezug auf meine Möglichkeiten von männlichen Altersgenossen unterscheiden könnte, auf diese Idee wäre ich nicht gekommen. Im Erwachsenenalter hat mich die Diskussion über das Gendern dann tatsächlich erst einmal irritiert. Ich hatte das Gefühl es geht in vielen Debatten ums Prinzip, und ums Prinzip diskutiere ich nicht gerne. Auch heute noch beobachte ich in diesen Debatten oft mehr Emotionen als gute Argumente. Ich hab mich daher endlich einmal an einem verregneten Samstagvormittag mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Thema geschlechtergerechte Sprache auseinandergesetzt. Dieser Beitrag ist das Ergebnis.
Mehr als nur politische Korrektheit: Die messbaren Effekte geschlechtsspezifischer Sprache
Die Forschung zeigt: Geschlechtsspezifische Sprache ist mehr als nur ein politisches Streitthema. Sie beeinflusst nachweisbar unsere Wahrnehmung, unser Denken und sogar unsere Leistungsfähigkeit. Ein Experiment, das besonders überrascht, wurde mit hebräischsprachigen Studierenden in Israel durchgeführt. Im Hebräischen, ähnlich wie im Deutschen, werden Anredeformen je nach Geschlecht angepasst.
Die Forscher stellten fest:
Wenn Frauen mit weiblichen statt mit männlichen Formen angesprochen wurden, verringerte sich der Geschlechterunterschied bei Mathematikleistungen um etwa ein Drittel!
Außerdem faszinierend schockierend: Als Frauen in männlicher Form angesprochen wurden, verbrachten sie weniger Zeit mit den Mathematikaufgaben und äußerten häufiger die Überzeugung, dass "Naturwissenschaften eher für Männer" seien. Die sprachliche Anrede beeinflusste also nicht nur die Leistung, sondern auch das Selbstbild und die Anstrengungsbereitschaft.
Auswirkungen im Recruiting
Die Auswirkungen nicht-inklusiver Sprache reichen weit über Laborexperimente hinaus. Eine Studie von Gaucher, Friesen und Kay aus dem Jahr 2011 liefert bemerkenswerte Erkenntnisse zum Thema sprachliche Barriere im Recruiting. Die Forschenden führten eine umfassende Analyse von etwa 4.000 Stellenanzeigen durch und fanden heraus, dass Jobangebote für männerdominierte Berufe 38% mehr stereotypisch männliche Wörter enthielten als Anzeigen für frauendominierte Berufsfelder. Die Ergebnisse im Detail:
- Geschlechtsspezifische Sprachmuster: Stellenanzeigen in männerdominierten Feldern (z.B. Elektriker, Mechaniker, Programmierer) verwendeten überwiegend maskuline Sprache.
- Abschreckende Wirkung auf Frauen: Die Verwendung männlich-kodierter Wörter wie "durchsetzungsfähig" oder "analytisch" in Stellenbeschreibungen machte diese Positionen für Frauen deutlich weniger attraktiv.
- Selbstselektion trotz Qualifikation: Frauen bewarben sich mit geringerer Wahrscheinlichkeit auf Stellen, deren Beschreibungen männlich-kodierte Sprache enthielten – selbst wenn sie für die Rolle qualifiziert waren.
- Einseitige Wirkung: Männliche Bewerber hingegen ließen sich von weiblich-kodierter Sprache in Stellenanzeigen nicht abschrecken.
Gaucher, D., Friesen, J., & Kay, A. C. (2011). Evidence that gendered wording in job advertisements exists and sustains gender inequality. Journal of Personality and Social Psychology, 101(1), 109–128. https://doi.org/10.1037/a0022530
Diese Forschungsergebnisse wurden durch eine Studie der Technischen Universität München weiter untermauert. Die Studie bestätigte, dass Frauen sich weniger geneigt fühlten, sich zu bewerben, und die Positionen weniger ansprechend fanden, wenn Stellenanzeigen viele mit Männern assoziierte Eigenschaften enthielten. Diese Erkenntnisse verdeutlichen, wie stark sich geschlechtsspezifische Sprache in Stellenanzeigen auf den Bewerberpool auswirken kann, was potenziell zu einer Verfestigung von Geschlechterungleichgewichten in bestimmten Berufen führt.
Quelle: TUM
Die kulturelle Dimension: Sprache formt Denken
Eine besonders interessante Erkenntnis stammt aus kulturübergreifenden Studien: Gesellschaften mit stärker geschlechtsspezifischen Sprachen weisen oft eine größere Geschlechterungleichheit in verschiedenen Bereichen auf, einschließlich wirtschaftlicher Teilhabe und politischer Repräsentation.
Mehrere Forschungsarbeiten belegen schockierende Zusammenhänge
Van der Velde beobachtete, dass die geschlechtsspezifische Lohnlücke in Ländern mit einer nach dem Geschlecht stark differenzierenden Sprache signifikant erhöht ist. Mavisakalyan kam zu dem Ergebnis, dass solche Länder auch von niedrigerer weiblicher Erwerbsbeteiligung geprägt sind. Santacreu-Vasut et al fanden heraus, dass die Verbreitung von geschlechterdifferenzierender Grammatik in der Sprache das Vorhandensein und die Durchsetzung von politischen Frauenquoten signifikant erklärt. Dieselben Forschenden stellten einen solchen Zusammenhang auch für die Geschlechtlichkeit von Sprachen und die Präsenz von Frauen auf unterschiedlichen Ebenen in Unternehmen fest, beispielsweise im Aufsichtsrat und im gehobenen Management. Besonders aufschlussreich ist eine Studie von Hicks et al: Mit einem epidemiologischen Ansatz untersuchten sie den Zusammenhang zwischen der Bedeutung von Geschlecht in der Muttersprache und geschlechtstypischer Arbeitsteilung im Haushalt unter Personen mit Migrationshintergrund in den USA.
Das Ergebnis:
In Haushalten von Individuen, in deren Muttersprache die grammatische Struktur stark nach dem Geschlecht differenziert, liegt die Wahrscheinlichkeit einer geschlechterstereotypischen Aufteilung der Hausarbeit signifikant höher.
Quellen
L. van der Velde, K. Goraus, J. Siwińska, J. Tyrowicz: Language and (the Estimates of) the Gender Wage Gap, in: Economics Letters, 136. Jg. (2015), H. 11, S. 165-170. A. Mavisakalyan: Gender in Language and Gender in Employment, in: Oxford Development Studies, 43. Jg. (2015), H. 4, S. 403-424. E. Santacreu-Vasut, A. Shoham, V. Gay: Do female/male distinctions in language matter? Evidence from gender political quotas, in: Applied Economics Letters, 20. Jg. (2013), H. 5, S. 495-498. D. L. Hicks, E. Santacreu-Vasut, A. Shoham: Does mother tongue make for women‘s work? Linguistics, household labor, and gender identity, in: Journal of Economic Behavior & Organization, 110. Jg. (2015), S. 19-44.
Ist neutrale Sprache wirklich neutral? Das Dilemma vermeintlich geschlechtsneutraler Begriffe
Reicht es aus, auf vermeintlich "neutrale" Begriffe wie "Person", "Mensch" oder "Kind" auszuweichen? Die Forschung liefert hier eine überraschende Antwort. Eine Studie der New York University, veröffentlicht im renommierten Fachjournal PNAS, untersuchte über 800 Eltern-Kind-Paare und kam zu einem bemerkenswerten Ergebnis: Selbst bei der Verwendung geschlechtsneutraler Begriffe wie "Kind" zeigt sich eine deutliche unbewusste männliche Voreingenommenheit. Die Forscherinnen um Rachel Lesin fanden heraus, dass Eltern bei der Beschreibung von Buben häufiger den neutralen Begriff "Kind" verwendeten, während sie bei Mädchen eher geschlechtsspezifische Bezeichnungen benutzten. Konkret:
- Wenn Eltern Fotos von spielenden Kindern beschreiben sollten, verwendeten sie für Buben öfter geschlechtsneutrale Bezeichnungen ("Das Kind rutscht")
- Bei Mädchen griffen sie hingegen häufiger zu geschlechtsspezifischen Bezeichnungen ("Dieses Mädchen schaukelt")
Noch interessanter wurde es, als die Forscher:innen Bilder zeigten, die Kinder bei nicht-stereotypen Aktivitäten zeigten (z.B. ein Mädchen, das im Dreck gräbt, oder ein Junge, der sich die Nägel lackiert). Hier drehte sich das Muster um: Plötzlich bezeichneten Eltern ein Mädchen, das nach Würmern gräbt, häufiger als "Kind" als einen Jungen, der sich die Nägel lackiert. Diese Ergebnisse legen nahe, dass wir selbst bei der Verwendung vermeintlich neutraler Begriffe oft unbewusst eine männliche Norm voraussetzen.
Quelle: R.A. Leshin, J. Benitez, S. Fu, S. Cordeiro, & M. Rhodes, “Kids and Girls”: Parents convey a male default in child-directed speech, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 122 (11) e2420810122, https://doi.org/10.1073/pnas.2420810122 (2025).
Was bedeutet das für unsere Bemühungen um geschlechtergerechte Sprache? Möglicherweise reicht es nicht aus, einfach nur "neutrale" Begriffe zu verwenden, solange diese Begriffe in unserer Wahrnehmung immer noch männlich konnotiert sind.
Ein persönliches Nachwort
Die Recherche für diesen Artikel hat mich überrascht, in manchen Fällen schockiert, und meine Perspektive nachhaltig verändert. Bewusstsein schaffen ist der erste Schritt zur Veränderung. Unser Ziel ist es, mit Nejo dazu beizutragen. Du findest daher auf Nejo die generisch feminine Form ebenso häufig wie die maskuline Form, wenn wir nicht durchgängig mit Doppelpunkt (Bewerber:innen) arbeiten. Wir sind nicht perfekt, und freuen uns immer über Anregungen oder Feedback, wie wir unsere Sprache noch inklusiver gestalten können. Schreib mir bitte an mona@mynejo.com.
Dieser Beitrag wurde das erste Mal am veröffentlicht. Letztes Update am .